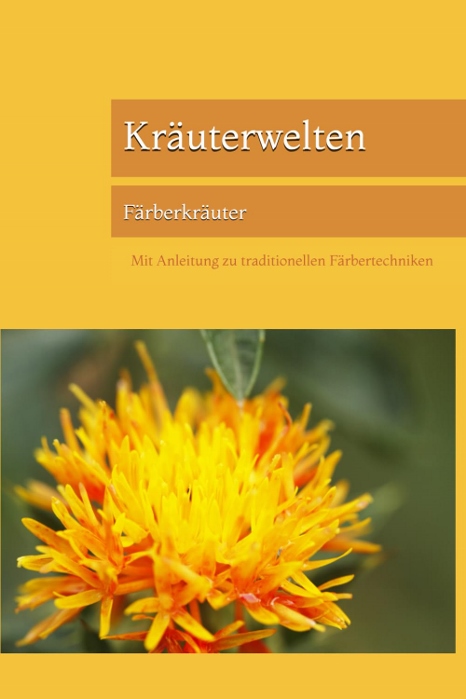Unter dem Namen Löwenzahn gibt es bisweilen zwei verschiedene Gattungen. Da wäre zunächst der echte Löwenzahn (Taraxacum), der wegen seiner kugelförmigen Flugschirme, die nach der Blütezeit an der Pflanze entstehen und sich durch den Wind verbreiten, auch Pusteblume bekannt ist. Seine kräftig gelben, gefüllten Blütenstände sind unverkennbar und wuchern auf unzähligen Blumenwiesen.
Daneben gibt es noch den Schaftlöwenzahn (Leontodon), auch Milchkraut genannt. Seine Körbchenbblüten sind filigraner und zarter als bei Taraxacum und erinnern stark an Pippau, was regelmäßig zu Verwechslungen führt. Auch ähneln sich die markant gezähnten Blätter beider Löwenzahngattungen, was die Pflanzenbestimmung nicht gerade einfacher macht.
Inhaltsverzeichnis
ToggleLöwenzahn in der Küche und Medizin
Wenngleich sich die beiden Löwenzähne Taraxacum und Leontodon sehr ähnlich sehen, gibt es doch einen grundlegenden. Denn anders als der Schaftlöwenzahn wird echter Löwenzahn nicht nur als dekorative Gartenblume oder Küchenkraut, sondern auch als Heilpflanze genutzt. Bei der Bestimmung kommt es diesbezüglich nicht nur zu Verwechslungen miteinander, sondern auch mit manchem Artverwandten. Dazu gehört neben Pippau auch die Zichorie alias Wegwarte.
Ein persisches Heil- und Küchenkraut
Die Verwirrung um die Zuordnung des Begriffes „Löwenzahn“ beginnt schon beim Namen. Der wissenschaftliche Gattungsname des Milchkrauts Leontodon heißt übersetzt nämlich tatsächlich Löwenzahn, während sich der wissenschaftliche Name Taraxacum für echten Löwenzahn aus dem Persieschen ableitet. Er ist dem bedeutendsten arabischen Mediziner der Antike, Al-Razi, zu verdanken, der den Löwenzahn um 900 n. Chr. zum ersten Mal in seinen Aufzeichnungen erwähnte und schrieb:
„Der Tarashaquq ist wie Zichorie“
In der Tat haben Taraxacum und Leontodon mit der Zichorie einiges gemeinsam. Ihre namensgebenden, an Löwenzähne erinnernden Blätter werden nämlich ebenfalls gern als Zutat für Gemüsebeilagen und Wildkräutersalat genutzt. Selbst Brot, Gemüsesuppen und sogar Honig oder Marmelade gelingen mit Blättern und Blüten der Löwenzähne ausgezeichnet. Dabei ist es im Übrigen egal, ob man nun Taraxacum oder Leontodon verwendet, denn beide Pflanzen sind essbar und damit als Blatt- bzw. Blütengemüse geeignet.

Wirkung und Inhaltsstoffe von Taraxacum
Auch heilpflanzlich gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen Zichorie und Löwenzahn. So werden beide Pflanzen beispielsweise gegen Appetitlosigkeit empfohlen. Ein Auszug aus Zichorien- und Löwenzahnwurzel in Kombination mit Pfefferminze soll wiederum den Gallenfluss verbessern und die Leber stärken.
Taraxacum hilft weiterhin bei Atemwegs- und Gelenkbeschwerden, Harnwegserkrankungen, Hautleiden, Stoffwechselstörungen und Verdauungsproblemen. Auch hierfür kommt die Taraxacum-Wurzel (Radix taraxaci) zum Einsatz, die heilpflanzlichen Anwendung entweder zu Tee, Tinktur oder Salbe verarbeitet wird.
Für die Heilwirkung der Löwenzahnwurzel sind maßgeblich die in ihr enthaltenen Flavonoide, Schleimstoffe, Gerb- und Bitterstoffe verantwortlich. Sie sorgen unter anderem für eine antibiotische, entzündungshemmende sowie sekretfördernde Wirkung von Taraxacum.
Gerade der pflanzeneigene Bitterstoff Taraxin ist ferner für seine beruhigende und krampflösende Wirkung berühmt. Die harntreibenden Eigenschaften von Taraxacum prädestinieren die Blume außerdem als natürliches Diuretikum und brachten der Pflanze im Altertum Beinamen wie Pissblume oder Bettpisser ein.
Wesentlich charmanter sind da schon volkstümliche Namen, die von der ursprünglichen Assoziation von Leontodon mit der als Zichorie bekannten Wegwarte herrühren. Gebräuchlich sind hier Beinamen wie Gelbe Wegwarte oder wilde Zichorie. In diesem Zusammenhang wird übrigens auch die Löwenzahnwurzel wie schon die Zichorie gerne als Kaffeeersatz genutzt.

Löwenzahn pflanzen – Standort und Aussaat
Sowohl Taraxacum als auch Leontodon gehören zur Familie der Korbblütler. Dabei sind beide Löwenzähne von den Tropen bis zum Polarkreis weit verbreitet. Sie sind also recht anpassungsfähig und robust, was eine relativ unkomplizierte Kultur im Garten ermöglicht.
Dabei macht sich Löwenzahn nicht nur auf der Blumenwiese schön. Auch auf der Bienenweide sowie in Kräuter-, Gemüse und Naturgärten können größere Bestände ihre ziervolle wie nützliche Wirkung entfalten. Ein besonders beliebter Pflanzpartner ist dabei das Gänseblümchen.
Standort für Löwenzähne
Am Standort verträgt Löwenzahn sonniger wie halbschattige Lagen gleichermaßen gut. Zudem ist die Pflanze ein Anzeiger für Stickstoff im Boden, was bedeutet, dass sie auf stickstoffhaltigem Grund besonders üppig gedeiht. Dementsprechend sollte das Bodensubstrat pH-Werte im neutralen bis schwach basischen Bereich, zwischen 6,5 und 8 Punkten aufweisen. Insgesamt ist ein sandig-lehmiges Substrat zu empfehlen.
Einzelheiten zum Standort für Löwenzähne:
- Löwenzähne sind winterhart und sehr robust
- sonnige bis halbschattige Standorte wählen
- Boden sollte sandig-lehmig sein
- Boden-pH-Wert: neutral bis basisch bei 6,5 – 8 Punkten

Aussaat von Löwenzahn
1. Schritt – Aussaattermin wählen: Die Aussaat der Löwenzähne kann von März bis Mai erfolgen. Ob im Beet oder auf der Wiese gesät wird, bleibt dem Gärtner überlassen.
2. Schritt – Boden vorbereiten: Reichern sie das Substrat vor der Aussaat bei Bedarf mit etwas Sand an. Bei Pflanzen, die als Blattgemüse bestimmt sind, kann das Saatgut zusätzlich im Herbst vorgebeizt werden, was den Bitterstoffgehalt reduziert und die Löwenzahnblätter schmackhafter macht.
3. Schritt – Löwenzahn aussäen: Die Pflanzenrosetten der Löwenzähne können bis zu 20 cm breit werden. Halten Sie bei der Aussaat also dementsprechend einen angemessenen Saatabstand ein.
Kurzschritte zur Aussaat im Überblick:
- Aussaattermin: März bis Mai
- Boden ggf. mit Sand anreichern
- Vorbeizen des Saatguts neutralisiert Bitterstoffe
- Saatabstand: 20 cm

Löwenzahn mähen und ausstechen
Manuelle Bewässerung ist am Löwenzahn gemeinhin nicht nötig. Auch eine Düngung entfällt größtenteils, womit die nützliche Blume relativ pflegeleicht ist. Ein größeres Augenmerk muss man dagegen auf die Vermehrungsgewohnheiten von Taraxacum und Leontodon legen.
Sobald er nach der Blütezeit nämlich seine charakteristischen Pusteblumen ausgebildet hat, vermehrt er sich rasend schnell. Das ist gerade für Rasenflächen oft nachteilig, denn die Rosetten der Pflanze zerstören die Grasnarbe.
Wer die Ausbreitung der Löwenzähne eindämmen möchte, kann an den gewünschten Stellen Kalk ausbringen. Diesen mag die Blumenstaude nämlich so gar nicht. Alternativ können Sie Taraxacum und Leontodon durch kontinuierliches Rasenmähen im Zaum halten oder die Blattrosetten regelmäßig mit einem Unkrautstecher ausstechen.
Wichtig beim Ausstechen ist, dass die Pflanzen mitsamt ihrer Pfahlwurzeln ausgestochen werden. Diese reichen mitunter sehr tief und sorgen dafür, dass Löwenzahn immer wieder nachwächst, wenn die Wurzeln nicht vollständig entfernt werden.
Kurztipps zum Mähen und Ausstechen:
- Vermehrung durch rege Selbstaussaat
- zur Prävention Rasen regelmäßig mähen
- Aussaat von Pusteblumen muss verhindert werden
- bei zu starker Ausbreitung Pfahlwurzeln ausstechen
- Kalkausgaben vertreiben Überwucherung ebenfalls

Löwenzahn ernten
Die ausgestochenen Wurzeln von Taraxacum können anschließend zu heilpflanzlichen Zwecken verwendet werden. Frische Blüten und Blätter sammelt man ergänzend während der Blüte. Bitte ernten Sie nur Pflanzenteile, die an ungedüngten Standorten und fernab von Verkehrsstraßen und Orten mit hoher Luftverschmutzung wachsen. Immerhin werden entsprechende Schadstoffe von der Pflanze aufgenommen und sollten nicht mit verzehrt werden.
Achtung: Der Milchsaft aus den Stängeln der Löwenzähne hinterlässt auf der Kleidung unansehnliche braune Flecken! Diese lassen sich nur aus Textilien entfernen, wenn sie noch frisch und feucht sind. Ältere Flecken bekommt man (mit Glück) nur mit Scheuerbürste und Sandseife wieder heraus. Am besten ist es darum, bei der Ernte alte Kleidungsstücke zu tragen.
Kurztipps zur Ernte:
- Ernte von Blüten und Blättern im Frühling
- nur unvorbelastete Pflanzen ernten
- ausgestochene Wurzeln evtl. weiterverarbeiten
- Milchsaft der Löwenzähne hinterlässt braune Flecken
- bei der Ernte darum lieber alte Kleidung tragen
Interessante Arten von Taraxacum und Leontodon
Die zwei Gattungen der Löwenzähne beherbergen weit über 400 verschiedene Arten. Unter den Taraxacum-Arten gibt es hier einige äußerst interessante Varianten. Zu nennen wäre hier zum Beispiel der Weiße Löwenzahn (Taraxacum albidum), der namensgemäß weiß blüht.
Auch einen Rosa Löwenzahn (Taraxacum pseudoroseum) gibt es, der dank seiner rosa bis weiß-gelben Blütenfärbung besonders außergewöhnliche Akzente im Garten setzt.
In der Heilkunde und Küche genutzt wird aber meist der Klassiker unter den Löwenzähnen, der Gewöhnliche Löwenzahn (Taraxacum officinale). Von ihm gibt es auch verschiedene Sorten für die Kräuter- und Salatküche, die einen besonders guten Geschmack oder schöne großer Salatblätter besitzen. Hierzu gehören:
- ‚Cabbage Leaved‘
- ‚Dente di Leone‘
- ‚Lyonell‘
- ‚Vert de Montmagny‘
Als besonders beliebte Arten des Leontodon gelten wiederum vor allem der Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis) sowie das auch als Rauer Löwenzahn bekannte Raue Milchkraut (Leontodon hispidus). Letzeres ist als Kaffeeersatz und Futterpflanze für Rinder sowie als Zutat in Blumenmischungen in Gebrauch.
Mögliche Krankheiten und Schädlinge
Es sind keine besonderen Schadbilder für Löwenzähne bekannt.
Fazit
Löwenzahn gilt einigen als ungeliebtes Unkraut im Rasen. Allerdings hat die goldgelb strahlende Blume auch nützliche Eigenschaften und wird als Heilkraut vielseitig gebraucht. In der Küche sind die Blätter von Taraxacum und Leontodon zudem ein altes Traditionsgemüse, mit dem sich sowohl deftige, als auch süße Rezepte verwirklichen lassen. Da Löwenzähne darüber hinaus auch äußerst anspruchslos und robust sind, kann eine kontrollierte Kultur durchaus lohnenswert sein.
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von Das Grüne Archiv
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.