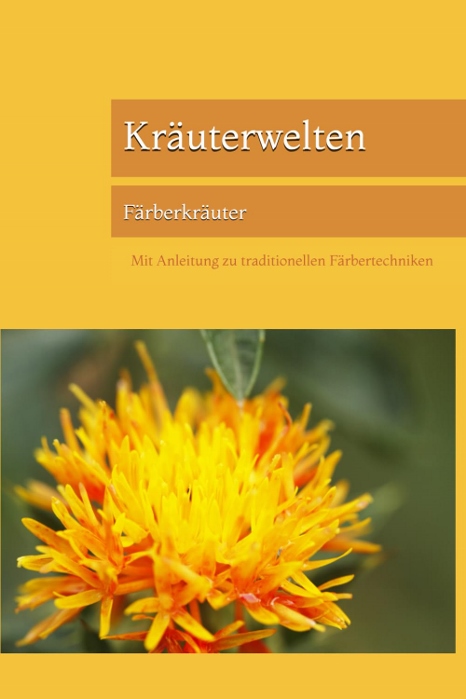Eine lange Ecktheke besitzt die Kräuterküche im Kräuterarchiv. Dazu verschiedene Kochutensilien und Vorratsregale, in denen sich fein säuberlich beschriftet Kräuter von A bis Z tummeln. Frische Leinentücher und abgekochte Schraubgläser auf der Anrichte verraten, dass hier viel ausgepresst und abgefüllt wird.
Die kleine Kräuterschale mit erlesenen Pflanzentrieben auf dem hölzernen Ecktisch wirkt recht dekorativ und lässt einen Betrachter umgehend an ein Dutzend möglicher Rezeptideen denken. Du kannst an dieser rustikalen Kräuterküche einfach vorbeigehen oder aber kurz verweilen und…
…oder einfach mal die hiesigen Kräuterrezepte studieren…
Rezepte aus der Kräuterküche:
In Anbetracht der saisonalen Küchendeko scheinen die Jahreszeiten in der Kräuterküche eine wichtige Rolle zu spielen. Wer sich etwas mit Traditionsfesten auskennt, der bemerkt schnell, dass hier der keltische Jahreskreis als Inspirationsquelle gedient hat.
Keltische Feiertage
Kräuter Bräuche und Rezepte
Von Küchenkräutern und Kräuterextrakten
Die Küche dient als zentraler Verarbeitungsort von Kräutern. Das Wort Küchenkräuter stiftet hierbei aber manchmal Verwirrung. Viele denken, es handle sich bei diesen Kräuterpflanzen ausschließlich um Gewürzkräuter.
Doch auch wichtige Heilkräuter aus der Hausapotheke, die häufig zu Tee oder anderen heilsamen Kräuterextrakten verarbeitet werden, gehören zu den Küchenkräutern.
Als besonders wichtige Kräuterextrakte für die Küche gelten neben Kräutertee und Kräuteröl vor allem Tinkturen, Salben und Cremes. Manch eine Kräuterhexe hat in der Kräuterküche zudem die Leidenschaft für Zaubertränke entdeckt.
Darüber hinaus eignen sich viele Kräuter auch zur Herstellung von gesunden Kräutersäften, Kräuterwein und Kräuterschnäpsen. Die Geschmacksknospen kommen beim Arbeiten mit Küchenkräutern also voll auf ihre Kosten. Und auch die Gesundheit profitiert von den Extrakten aus der Kräuterküche.
Kräutertee zubereiten
Zur Herstellung von Kräutertee gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Die meisten Teekräuter sind heutzutage vordosiert in fertigen Teebeuteln erhältlich, die lediglich in eine Teekanne oder Tasse eingehängt und mit kochendem Wasser übergossen werden müssen.
Nach einer kurzen Ziehzeit können Sie die Teebeutel dann entnehmen und den Tee entweder ungesüßt oder mit Zucker, Kandis oder Honig gesüßt trinken. Auch der Zusatz weiterer aromatischer Bestandteile wie Zimt oder Zitrone ist möglich.
Nun gibt es in der Kräuterküche allerdings auch viele erfahrene Kräuterliebhaber, die bei der Teezubereitung lieber auf lose Kräuter setzen. Sie bevorzugen die Nutzung von speziellen Teelöffeln, Teeeiern oder Teekannen mit integriertem Kräutersieb. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nach Belieben individuelle Kräutermischungen verwenden kann, die teilweise auch ganz bestimmte Heilwirkungen unterstützen.
Bei Erkältung oder Husten sind zum Beispiel Teemischungen aus Salbei, Pfefferminze, Melisse und Thymian sinnvoll. Verdauungsbeschwerden legen dagegen eine Mischung aus Fenchel, Anis und anderen Bitterkräutern nahe. Darüber hinaus lassen sich lose Kräuter auch flexibler dosieren, wobei hier milde Kräuter (z.B. Kamille) einen höheren Anteil haben sollten, um Überdosierungen hochwirksamer Zusatzkräuter zu vermeiden.
Wissenswertes
Puristen lehnen den Begriff „Kräutertee“ gänzlich ab und bezeichnen ihn stattdessen als Kräuterinfusion. Ihrer Auffassung nach können als Tee nur Auszüge der echten Teepflanze bezeichnet werden. Der Begriff leitet sich vom chinesischen Wort tcha (茶) bzw. tchaje (茶葉) für „Teeblätter“ ab und wurde erst im Rahmen des globalen Teeexportes über die Jahrhunderte zu einem Oberbegriff für wässrige Auszüge getrockneter Kräuter.
Zubereitung: Die Ziehzeit richtet sich bei Teekräutern in der Regel nach dem Härtegrad der Kräuter sowie der gewünschten Wirkstoffkonzentration. Bei weichen Pflanzenteilen wie Blüten oder Blättern, die nur für einen herkömmlichen Tagestee gedacht sind, genügt meist eine Ziehzeit von 3 bis 5 Minuten.
Getrocknete Pflanzenwurzeln, ebenso wie Baumrinden oder harte Pilzknollen erfordern dagegen oft eine etwas längere Ziehzeit von ca. 10 bis 15 Minuten. Auch ein besonders starker Tee, der zur Behandlung schwerer Krankheiten gedacht ist, muss für gewöhnlich etwas länger ziehen als üblich. Als Faustregel für die Dosierung von Kräutertee gilt dabei meist:
- 1 Teebeutel / 1 bis 2 TL Kräuter für eine Tasse Tee (ca. 250 ml)
- 2 Teebeutel / 3 bis 5 TL Kräuter für eine Kanne Tee (ca. 750 ml)
FAQs zu Kräuterrezepten
Kräuter können in der Küche verwendet werden, um Speisen zu würzen, Pestos, Suppen, Salate, Kräuterbutter oder Dressings herzustellen. Auch die Herstellung von Kräuterlikören und Kräuterwein ist denkbar.
Außerdem eignen sich Kräuter für die Zubereitung von Tees, Tinkturen und Ölauszügen. In der Naturkosmetik werden sie für die Herstellung von Cremes, Salben, Shampoos und Badezusätzen genutzt. Die Kräutertherme im Grünen Archiv bietet hier schöne Anreize für passende Rezepte.
Zudem finden Kräuter Anwendung in der Naturheilkunde zur Behandlung von Krankheiten und Beschwerden. Duftkräuter sind ideal für Potpourris, Duftsäckchen und Aromatherapie. Schließlich können Kräuter auch getrocknet und in Kräuterkissen oder als Räucherwerk verwendet werden.
Einfach und lecker sind Kräuterbutter, Kräuterquark oder Pesto. Für Kräuterbutter mischen Sie weiche Butter mit gehacktem Schnittlauch, Petersilie und etwas Knoblauch. Kräuterquark gelingt mit Quark, Schnittlauch, Petersilie und einem Spritzer Zitronensaft. Für Pesto benötigen Sie Basilikum, Pinienkerne, Knoblauch, Parmesan und Olivenöl.
Kräuterrezepte bereichern die Ernährung durch ihren hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Kräuter wie Basilikum, Petersilie, und Koriander liefern essentielle Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin K, und Eisen. Viele Kräuter fördern die Verdauung und Entgiftung des Körpers, weshalb sie für gesunde Diäten und Detox-Programme wie die Frühjahrskur von unschätzbarem Wert sind. Andere Kräuter stärken das Immunsystem und haben antibiotische oder entzündungshemmende Eigenschaften, was sie zu gerade im Winter zu einer Bereicherung für die Ernährung macht.
Darüber hinaus verleihen Kräuter Gerichten Geschmack und Aroma, wodurch der Bedarf an Salz und Zucker reduziert wird. Die Verwendung frischer Kräuter in Salaten, Suppen, Smoothies und als Garnitur macht Mahlzeiten nicht nur gesünder, sondern auch schmackhafter.
Ja, viele Kräuterrezepte sind für Kinder geeignet und können ihnen helfen, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. Milde Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Schnittlauch sind ideal für Kindergerichte, da sie sanft im Geschmack sind. Kräuter können in Suppen, Saucen, Smoothies und selbstgemachten Snacks für Kinder verwendet werden. Für Kinder ungeeignet sind jedoch alkoholische Kräuterrezepte wie Tinkturen, Kräuterwein oder Kräuterlikör.
Beliebte Küchenkräuter sind Basilikum, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Koriander und Minze. Diese Kräuter verleihen Gerichten Frische und Aroma und sind vielseitig einsetzbar. Sie passen zu Salaten, Suppen, Fleischgerichten und Desserts und sind sowohl frisch als auch getrocknet verwendbar.
Basilikum eignet sich hervorragend für italienische Gerichte und Tomatensaucen. Rosmarin passt gut zu Fleischgerichten wie Lamm und Geflügel. Dill harmoniert mit Fisch und Gurkensalaten. Minze verfeinert Desserts und Getränke, während Thymian Suppen, Eintöpfe und Bratengerichte würzt.
Als gute Hausmittel gegen Erkältung sind Kräutertees besonders wirksam. Ein Ingwertee mit Zitrone und Honig lindert Halsschmerzen und stärkt das Immunsystem. Thymiantee wirkt schleimlösend und beruhigt Husten. Für eine Erkältungsbalsam können Sie Rosmarin, Eukalyptus und Pfefferminzöl mit etwas Kokosöl mischen und auf Brust und Rücken auftragen. Eine heiße Hühnersuppe mit viel Knoblauch, Ingwer und Petersilie hilft ebenfalls, die Erkältungssymptome zu lindern. Für ein Inhalationsbad geben Sie Kamille und Eukalyptus in heißes Wasser und inhalieren den Dampf, um die Atemwege zu befreien.
Bei Schnupfen hilft eine Inhalation mit Kamille und Eukalyptus, die Nasenwege zu befreien. Geben Sie eine Handvoll Kamillenblüten und ein paar Tropfen Eukalyptusöl in eine Schüssel mit heißem Wasser und inhalieren Sie den Dampf für 10-15 Minuten. Ein Tee aus Pfefferminze und Thymian kann ebenfalls die Atemwege öffnen und Entzündungen lindern. Für eine Nasenspülung eignet sich eine Mischung aus Salbei und Salzwasser, die den Schleim löst und die Nase reinigt. Unser Ratgeber zu Hausmitteln gegen Schnupfen bietet weitere Infos.
Nützliche Hausmittel gegen Verstopfung sind Fenchel, Anis und Kümmel. Ein Tee oder eine Suppe mit diesen Kräutern fördert die Verdauung und lindert Blähungen. Ein weiteres wirksames Mittel ist ein Tee aus Löwenzahnwurzel, der leicht abführend wirkt und die Leberfunktion unterstützt. Flohsamenschalen, in Wasser eingeweicht, bilden ein gelartiges Mittel, das die Darmtätigkeit anregt und die Verdauung erleichtert.
Ja. Gerade Hausmittel gegen Winterdepression finden sich unter den Kräuterrezepten einige. Beispielsweise sind Johanniskraut- und Lavendeltee sehr beliebte Rezepturen zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Depressionen. Zweimal täglich getrunken, können die Tees die Stimmung verbessern. Zitronenmelisse wirkt ebenfalls beruhigend und kann bei Angstzuständen und nervöser Unruhe helfen. Und auch ein Tee aus Passionsblume oder Baldrianwurzel fördert Entspannung und besseren Schlaf.
Eine besondere Empfehlung gegen Depressionen sind ferner Wellnessanwendungen mit Kräutern.