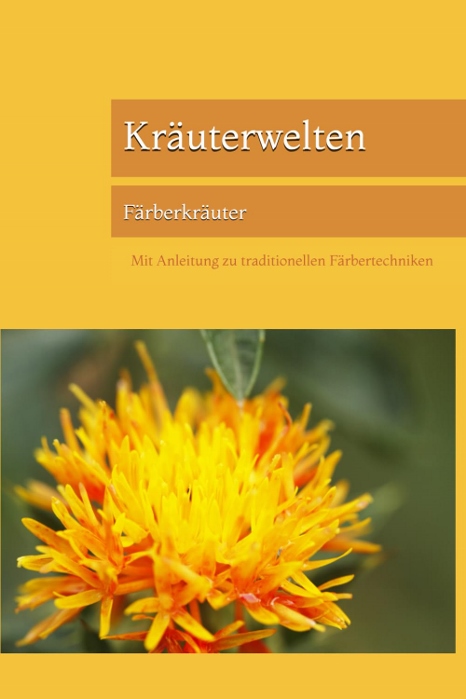Johanniskraut (Hypericum) ist als eines der besten pflanzlichen Antidepressiva bekannt. Vor allem dem wirkstoffreichen Öl der Heilpflanze, das aufgrund seiner roten Färbung auch Rotöl genannt wird, kommt hier eine wichtige Bedeutung in der heilpflanzlichen Behandlung von Depressionen und Co. zu. Allerdings besitzt Hypericum noch ganz andere Heilqualitäten, die das Kraut für eine Kultur im Kräutergarten prädestinieren.
Inhaltsverzeichnis
ToggleSteckbrief zu Johanniskraut
- Wissenschaftlicher Name: Hypericum
- Herkunft: weltweit
- Wuchshöhe: 15 bis 150 cm
- Blütezeit: Juni bis September
- Blüten: gelbe Radblüten
- Blätter: gegenständige, eiförmige Blätter
- Lichtverhältnisse: sonnig bis halbschattig
- Wasserbedarf: mäßig bis hoch
- Boden: sandig-lehmig
- Boden-pH-Wert: neutral
- Winterhärte: bis -25 °C winterhart
- Verwendung: Heilpflanze, Zierstaude
- Wirkung: adstringierend, antidepressiv, antimikrobiell, blutstillend, entzündungshemmend, krampflösend, schmerzstillend, wundheilend
Johanniskräuter im Volksbrauchtum
Das Johanniskraut ist das Kardinalkraut der sogenannten Johanniskräuter, zu denen neben Hypericum auch Beifuß, Eisenkraut, Kamille und Schafgarbe gehören. Die Heilkräuter blühen relativ punktgenau zu Mittsommer und sind daher wichtiger Bestandteil saisonaler Feste. Darunter auch der für Johanniskräuter namensgebende Johannistag am 24. Juni, der als Stichtag für die Blüte der Johanniskräuter gilt.
Die Pflanze ist also der biblischen Gestalt Johannes des Täufers geweiht und trägt dementsprechend volkstümliche Namen wie Herrgottsblut (auf die rote Farbe von Johanniskrautöl und Johanniskrauttinktur bezogen), St. Johannis Kraut oder im Englischen St. John’s Wort.
Das Blut der Märtyrer in einem Kraut gebunden
Um Hypericum ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden. So war die Heilpflanze im Mittelalter beispielsweise als Ritualkraut zur Teufels- und Hexenaustreibung in Gebrauch. Beinamen wie Hexenkraut, Teufelsflucht oder Jageteufel erinnern noch heute daran.
Laut Überlieferung sollen die perforierten Blätter des auch als Durchlöchertes oder Tüpfel-Johanniskraut bekannten Echten Johanniskrauts (Hypericum perforatum) dabei sogar vom Teufel selbst stammen. Er habe dem Heilkraut aus Bosheit über dessen heilige Schutzkraft gegen Dämonen und böse Geister kurzerhand mit Nadeln Löcher in die Blätter gestochen.
Auch Blutslegenden zu Hypericum gibt es diverse. Einer Sage nach erwuchs es einst aus dem Blut des Namenspatrons, Johannes dem Täufer, nach dessen Hinrichtung. Eine andere Legende besagt, dass Johanniskräuter unter dem Kreuz Christi gewachsen seien, um seine Blutstropfen aufzufangen.
So erkläre sich laut Volksglauben auch die rote Farbe, die Hypericum-Extrakten gemeinsam ist. Seines intensiven Farbverhaltens wegen ist die Pflanze demnach auch ein Färberkraut.
Das Ritualkraut der Sommersonnwende
Im heidnischen Brauchtum galt Hypericum wiederum als Zauberpflanze. So banden Mädchen zur Sommersonnwende zum Beispiel Blumenkränze aus Blüten der Johanniskräuter, die eine Art Lichtsegen und Sonnenverehrung darstellten.
Ein zu Mittsommer schweigend gepflückter Strauß aus sieben Blüten, der dann unters Kopfkissen gelegt wurde, sollte die große Liebe erscheinen lassen. Und aufs Dach gelegtes oder im Herd verbranntes Hypericum schützte laut Volksglauben vor Gewitterschäden und Blitzeinschlägen.

Wirkung von Johanniskraut
Die Verehrung von Hypericum kommt nicht von Ungefähr. Gerade Echtes Johanniskraut besitzt laut einer italienischen Rezension der Universität von Kalabrien vielfältige Heilwirkungen in der Volksheilkunde.1Mariangela Marrelli, Giancarlo Statti, Filomena Conforti, Francesco Menichini: New Potential Pharmaceutical Applications of Hypericum Species; in: Mini Reviews in Medicinal Chemistry, Volume 16, Issue 9, 2016; PMID: 26156546 PubMed
Das gilt Forschern neben der Nutzung von Hypericon zur Wundbehandlung auch für die Anwendung von Johanniskräutern gegen Depressionen, Entzündungen, Infektionen und Verdauungsbeschwerden. Bereits Plinius der Ältere erwähnte eine Heilpflanze namens Hypereikon, die bei Verbrennungen helfen sollte. Paracelsus schrieb über Hypericum:
„Es ist nicht möglich, daß eine bessere Arznei für Wunden in allen Ländern gefunden wird.“
Johanniskräuter für Nerven und Psyche
Die Wirkung von Johanniskräutern im Bereich der nervlichen und psychischen Beschwerden ist äußerst umfangreich und umfasst Anwendungsgebiete wie:
- Angstzustände
- Depressionen
- Epilepsie
- Ischias und Hexenschuss
- Migräne
- Neuralgien
- Schlaflosigkeit
Mit Blick auf die Anwendung von Johanniskräutern bei Depression seien diesbezüglich auch insbesondere Frauenleiden wie Wochenbettdepression, PMS oder wechseljahrsbedingte Depressionen erwähnt. Die Pflanze ist demnach auch ein traditionelles Frauenheilkraut, das sowohl bei Wechseljahrs- als auch Menstruationsbeschwerden eingesetzt wird.
Für die Einnahme von Johanniskräutern während der Wechseljahre gibt es in diesem Zusammenhang zahlreiche Spezialpräparate wie Kapseln oder Tees. Und auch wer Johanniskräuter gegen Angst, Depressionen und innere Unruhe verwenden möchte, findet hierzu medizinische Produkte wie Johanniskrauttee in der Apotheke, Drogerie oder gut sortierten Kräuterläden.
Hypericum bei Stoffwechsel- und Verdauungsbeschwerden
Charakteristisch für Hypericum ist eine beruhigende, krampflösende, schmerzstillende, aber auch sekretfördernde, anregende und entzündungshemmende Wirkung.
Besagte Eigenschaften prädestinieren Johanniskraut neben nervlichen und psychischen Beschwerden auch für eine Nutzung bei Stoffwechselproblemen und gestörter Verdauung. Denkbar ist in diesem Bereich beispielsweise eine Anwendung gegen:
- Appetitlosigkeit
- Blasenentzündung
- Blutdruck
- Durchfall
- Gicht
- Magenbeschwerden
- Magen-Darm-Entzündungen
- rheumatische Erkrankungen
- Verdauungsschwäche
Geht es um die medizinische Anwendung bei Blutdruck- und mit Krämpfen assoziierten Magen-Darm-Beschwerden, ist neben dem Echten auch das Langblättrige Johanniskraut (Hypericum oblongifolium) wissenschaftlich von Bedeutung.
Die Art soll laut einer pakistanischen Studie der Fachabteilung für Biologische und Biomedizinische Wissenschaften des Aga Khan University Medical College ein besonderes krampflösendes und blutdrucksenkendes Potential besitzen.2Arif-Ullah Khan, Munasib Khan, Fazal Subhan, Anwarul Hassan Gilani: Antispasmodic, bronchodilator and blood pressure lowering properties of Hypericum oblongifolium–possible mechanism of action; in: Phytotherapy Research, Volume 24, Issue 7, 2010; PMID: 19960425 PubMed
Ein Tee aus Johanniskräutern ist auch hier eine wunderbare Möglichkeit, um das beste aus Hypericum oblongifolium sinnvoll anzuwenden.

Hypericum zur Hautpflege, Gelenk- und Wundbehandlung
Die adstringierenden, abschwellenden, blutstillenden und desinfizierenden Eigenschaften von Johanniskräutern machen sie in der Wundbehandlung zu einem wertvollen Hilfsmittel.
Und auch zur Hautpflege oder bei Gelenkbeschwerden eignen sich Präparate aus Hypericum hervorragend. Insgesamt sind hier folgende Anwendungsgebiete bekannt:
- Beulen
- Blutergüsse
- Ekzeme
- Gelenkschmerzen
- Geschwüre
- Insektenstiche
- Juckreiz
- Quetschungen
- trockene Haut
- Verbrennungen
- Verrenkungen
- Verstauchungen
- Zerrungen
- Wunden
Inhaltsstoffe der Johanniskräuter
Johanniskräuter enthalten eine Fülle antibiotischer, hautpflegender sowie stoffwechsel- und verdauungsanregender Wirkstoffe. Zu nennen wären hier allen voran Bitterstoffe, Gerbstoffe und Flavonoide. Phytosterine wie ß-Sitosterol verleihen dem Heilkraut außerdem eine gute Wirkung bei hormonell bedingten Beschwerden.
Für die Wirkung von Johanniskräutern als Antidepressiva, sind laut einem Bericht der School of Pharmacy an der University of London maßgeblich die Wirkstoffe Hypericin und Hyperforin verantwortlich.3J Barnes, L A Anderson, J D Phillipson: St John’s wort (Hypericum perforatum L.): a review of its chemistry, pharmacology and clinical properties; in: Volume 53, Issue 5, 2001; PMID: 11370698 Oxford Academic Speziell Hypericin fungiert zudem als pflanzeneigener Farbstoff, der Extrakten wie Johanniskrautöl, -tee und -tinktur seine markante rote Farbe verleiht.
Ein besonders interessanter, wenn auch komplikativer Mechanismus von Hypericin ist außerdem seine Lichtsensitivität. Sie verleiht Johanniskräutern einerseits Nebenwirkungen wie eine phototoxische Hautreaktion bei Überdosierung oder besonderer Sonnenexposition. Andererseits lässt sich die durch Hypericin verursachte Lichtempfindlichkeit aber auch medizinisch nutzen.
Es gibt zum Beispiel Behandlungsansätze, die Hypericin in der Krebstherapie nutzen. Dabei wird Patienten vor der Behandlung Johanniskrautextrakt verabreicht und anschließend mit Sonnenlichtlampen oder Lasern das Krebsgewebe bestrahlt.
Die durch Hypericin photosensibilisierten Krebszellen sterben in Folge ab. Ein ähnliches Vorgehen zeigte in der Vergangenheit auch bei der Behandlung einiger multiresistenter Keime wie Staphylococcus aureus in eiternden Wunden positive Effekte.

Anwendung und Dosierung
Die gängigsten Anwendungsformen von Johanniskraut zur Einnahme sind Kapseln, Tabletten, Tees und Tinkturen. Äußerlich kommt das Kraut häufig als Salbe oder ein Ölauszug zum Einsatz.
Dosierungshinweise
Die übliche Dosierung für Johanniskraut-Kapseln oder -Tabletten beträgt etwa 300 mg des standardisierten Extrakts, dreimal täglich eingenommen, was einer täglichen Gesamtdosis von 900 mg entspricht.
Bei der Zubereitung von Johanniskraut-Tee werden ein bis zwei Teelöffel getrocknetes Kraut mit 250 ml heißem Wasser übergossen und nach 10 Minuten Ziehzeit abgeseiht. Es wird empfohlen, zwei bis drei Tassen täglich zu trinken.
Wechsel- und Nebenwirkungen von Hypericum
Wie bereits angesprochen, kann es durch den hohen Gehalt an Hypericin in der Kräuterpflanze zu einer erhöhten Photosensibilität kommen. Das ist vor allem zu beachten, wenn Sie Salben aus Johanniskräutern für die Gelenke oder Haut äußerlich anwenden oder das Öl zur Narbenpflege und Wundbehandlung einsetzen möchten.
In diesem Fall sollten Sie die betroffenen Hautstellen danach also für einige Tage vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Weitere Nebenwirkungen bei Überdosierung können
- Kopfschmerzen,
- Magen-Darm-Beschwerden,
- Müdigkeit
- und Schwindel
sein. Darüber hinaus sind einige Wechselwirkungen zwischen Hypericum und anderen Wirkstoffen bekannt.
Vor allem bei Einnahme von Hormonpräparaten wie der Anti-Baby-Pille, Antibiotika, Antidepressiva, AIDS-Medikamenten, Herzmedikamenten, Antiepileptika und Immunsuppressiva ist von der Anwendung entsprechender Präparate abzusehen. Schwangere und Kinder sollten gänzlich auf die Einnahme von Johanniskräutern verzichten.
Johanniskraut pflanzen – Standort und Aussaat
Johanniskräuter bilden die Stammgattung der mit nur sechs bis zehn Gattungen relativ kleinen Familie der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae). Diese zeichnen sich durch ihre sternähnlichen Radblüten aus, wobei die unverkennbaren Blüten von Hypericum in kräftigem gelb erstrahlen.
Auch fühlt sich Johanniskraut in der Sonne recht wohl, weshalb man die Pflanze getrost als Sonnenanbeter beschreiben kann. Das heißt aber nicht, dass Johanniskräuter keinen Frost vertragen würden.
Heimische Arten mit guter Winterhärte
Von den gut 505 weltweit verbreiteten Johanniskrautarten sind zahlreiche, bis -25 °C winterharte Arten auch in den gemäßigten Klimazonen Europas und sogar Sibirien heimisch, darunter
- Behaartes Johanniskraut (Hypericum hirsutum)
- Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)
- Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum)
- Niederlegendes Johanniskraut (Hypericum humifusum)
- Pfennigblättriges Johanniskraut (Hypericum mummularium)
- Quirlblättriges Johanniskraut (Hypericum coris)
- Schönes Johanniskraut (Hypericum pulchrum)
- Sumpf-Johanniskraut (Hypericum elodes)

Der richtige Boden für Johanniskräuter
In seinen Standortansprüchen zeigt sich Hypericum relativ anspruchslos. Wichtig ist ein sandiges und gut durchlässiges Substrat mit neutralen pH-Werten um die 7 Punkte.
Saure Boden-pH-Werte sind hingegen zu vermeiden, gerade dann, wenn Sie aus Johanniskräutern eine Tinktur oder Rotöl herstellen möchten. Denn auf sauren Böden nimmt Hypericum vermehrt das für Menschen giftige Cadmium auf, das in Folge auch auf Extrakte der Pflanze übergeht.
Da Johanniskräuter auch mit feuchten Böden zurecht kommen, bietet sich neben dem Kräutergarten auch eine Kultur als Wasser- bzw. Sumpfpflanze am Teichrand oder im Sumpfbeet an. Ebenfalls denkbar sind Unterpflanzungen von Hecken und größeren Stauden.
Die beste Pflanzzeit bzw. Zeit für die Aussaat von Hypericum ist dann entweder im Frühling oder Herbst. Halten Sie einen Pflanzabstand von 30 cm zwischen einzelnen Pflanzexemplaren und Saaten ein, damit sich die Johanniskräuter gut entwickeln können.
Einzelheiten zum Standort für Johanniskräuter:
- Standorte in der Sonne oder im hellen Halbschatten
- durchlässiger und sandiger Boden
- pH-Wert des Bodens: neutral, um die 7 Punkte
Aussaat von Johanniskraut
Johanniskräuter gibt es nicht besonders häufig vorgezogen zu kaufen. Bei der Kultur ist man daher oft auf die Aussaat der Samen angewiese. Diese findet man jedoch leicht im gut sortierten Garten- oder Kräuterfachhandel.
Aussaattermin wählen
Vorziehen können Sie Johanniskraut bereits im Frühling, zwischen März und April. Eine Direktsaat ins Freiland sollte erst nach den Eisheiligen im Mai erfolgen, damit den Keimlingen keine Spätfröste mehr drohen.
Zudem sollte der Boden für eine Keimung ausreichend warm sein. Ideale Keimtemperaturen herrschen hier maßgeblich im Sommer und Frühherbst. Alternativ ist deshalb auch eine Aussaat im Herbst, von September bis Oktober möglich.
Boden vorbereiten
Lockern Sie das Standortsubstrat vor der Aussaat gut auf. Zu schwere Böden werden vor der Ausbringung mit etwas Sand angereichert. Eine gute Empfehlung ist es, spezielle Kräutererde aus dem Handel zu verwenden.
Johanniskraut säen
Die Samen der Johanniskräuter zählen zu den Lichtkeimern. Aus diesem Grund sollte das Saatgut nicht mit Erde bedeckt, sondern nur oberflächlich angedrückt werden. Für die Keimung sind dann konstante Bodentemperaturen von 18 bis 25 °C notwendig. Zusätzlich müssen Sie das Saatgut bis zur Keimung konstant feucht halten.
Johanniskraut pikieren
Die Keimung erfolgt bei Hypericum für gewöhnlich nach etwa 7 bis 21 Tagen. Sobald die Keimlinge eine Wuchshöhe von 10 cm erreicht haben, werden sie vereinzelt. Der finale Reihenabstand beträgt dann je nach Art 25 bis 30 cm.
Johanniskräuter gießen und düngen
Auch wenn Johanniskräuter nicht sehr wasserhungrig sind, sollte das Substrat nie zu sehr austrocknen. Gießen Sie daher immer nach, wenn der Boden stark trocken erscheint.
Eine intensive Düngung von Hypericum ist ebenfalls nicht notwendig. Im Gegenteil, können zu starke Stickstoffgaben den Gehalt an Hypericin und damit die Wirkung der Pflanze schmälern. Eine jährliche Düngung während der Hauptwachstumsphase mit organischen Mitteln wie Hornspänen ist daher völlig ausreichend.
Johanniskraut schneiden und ernten
Ein Rückschnitt ist an Hypericum nur im Herbst vor etwaigen Winterschutzmaßnahmen notwendig. Schneiden Sie das Heilkraut hier bodennah zurück und decken Sie die Pflanze zum Schutz vor eisigem Schmelzwasser im Winter mit etwas Laub ab.
Die Ernte der Johanniskräuter erfolgt vor oder während der Blütezeit zwischen Juni und September. Gerade die Blütenknospen sind sehr Wirkstoffreich, jedoch können Sie auch die Blüten und Stängel des in Alkohol, Öl oder Wasser extrahieren. Vor der Weiterverarbeitung sollte Hypericum aber zunächst getrocknet werden.
Johanniskräuter vermehren
Vermehren Sie Johanniskräuter am besten via Aussaat oder Wurzelteilung. Die Aussaat erfolgt hierbei wie gewohnt im Frühling oder Herbst. In den Herbstmonaten ist alternativ dazu auch eine Teilung älterer Stauden möglich.
Mögliche Krankheiten und Schädlinge
Gefährlich werden können Johanniskräutern vor allem die sogenannte Rotwelke. Es handelt sich hierbei um eine Pilzerkrankung, die oftmals im zweiten Standjahr an Hypericum auftritt.
Man erkennt die Rotwelke an der namensgebenden Rotverfärbung der Triebe. Abhilfe kann hier nur ein geeignetes Fungizid oder aber die Entsorgung befallener Pflanzen im Restmüll schaffen.
FAQs zu Johanniskraut
Welche Wirkung besitzt Johanniskraut?
Johanniskraut hilft bei der Linderung von leichten bis mittelschweren Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen. Die Pflanze enthält Hypericin und Hyperforin, die die Stimmung verbessern und beruhigend wirken. Es wird auch bei Wunden und Hautentzündungen eingesetzt.
Wie wird Johanniskraut richtig angewendet?
Das Heilkraut kann als Tee, Kapsel, Tablette oder Öl angewendet werden. Für Tee wird ein Teelöffel getrocknetes Kraut mit heißem Wasser übergossen und 10 Minuten ziehen gelassen. Öl wird äußerlich auf die Haut aufgetragen. Beachten Sie die Dosierungsanweisungen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Arzt.
Gibt es Nebenwirkungen oder Risiken bei der Verwendung von Johanniskraut?
Hypericum kann Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel und Lichtempfindlichkeit verursachen. Es kann die Wirkung bestimmter Medikamente beeinflussen, einschließlich Antidepressiva und Verhütungsmittel. Eine Konsultation mit einem Arzt vor der Anwendung ist ratsam, besonders bei Einnahme anderer Medikamente.
Ist Johanniskraut winterhart?
Ja, die Pflanze ist winterhart und kann in gemäßigten Klimazonen im Freien überwintern. Die Pflanze bevorzugt gut durchlässige Böden und einen sonnigen Standort. Ein Rückschnitt im Herbst fördert gesundes Wachstum im nächsten Jahr.
Wie pflanze und pflege ich Johanniskraut im Garten?
Johanniskräuter bevorzugen sonnige Standorte und gut durchlässige Böden. Pflanzen Sie die Kräuter im Frühjahr oder Herbst. Einmal etabliert, benötigt es nur minimale Pflege. Gießen Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe. Schneiden Sie die Pflanze nach der Blüte zurück, um das Wachstum zu fördern und eine kompakte Form zu erhalten.
Studienbelege:
- 1Mariangela Marrelli, Giancarlo Statti, Filomena Conforti, Francesco Menichini: New Potential Pharmaceutical Applications of Hypericum Species; in: Mini Reviews in Medicinal Chemistry, Volume 16, Issue 9, 2016; PMID: 26156546 PubMed
- 2Arif-Ullah Khan, Munasib Khan, Fazal Subhan, Anwarul Hassan Gilani: Antispasmodic, bronchodilator and blood pressure lowering properties of Hypericum oblongifolium–possible mechanism of action; in: Phytotherapy Research, Volume 24, Issue 7, 2010; PMID: 19960425 PubMed
- 3J Barnes, L A Anderson, J D Phillipson: St John’s wort (Hypericum perforatum L.): a review of its chemistry, pharmacology and clinical properties; in: Volume 53, Issue 5, 2001; PMID: 11370698 Oxford Academic
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von Das Grüne Archiv
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.