Wer schon einmal in Singapur war, der weiß, was wirklich zukunftsweisende Stadtarchitektur wirklich bedeutet. Dabei spielen nicht nur futuristische ergonomische Formen von Fassaden eine wichtige Rolle, sondern auch eine üppige Fassadenbegrünung. Singapurs imposante Architekturprojekte wie der botanische Garten „Gardens by the Bay“, aber auch das Parkroyal on Pickering Hotel und die Scholl of the Arts strotzen nur so vor Biodiversität im Design.
Mit seiner bislang einzigartigen grünen Stadtarchitektur übernimmt Singapur eine wegweisende Modellfunktion für die Herausforderungen, die der Stadtplanung künftig angesichts des voranschreitenden Klimawandels bevorstehen. Eine mögliche Lösung: CO₂-aktive Pflanzen.
Fassadenbegrünung muss zum Standard werden
Laut eines Gutachtens aus dem Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt sind grüne Fassaden essenziell für die klimafreundliche Stadtentwicklung der Zukunft. Das Gutachten betont, dass funktionelle Fassadenbegrünung die einzige Möglichkeit sei, um einer durch den Klimawandel bedingten städtischen Überhitzung in den Sommermonaten vorzubeugen.
Ebenso sind Grünfassaden und Grünanlagen für den Erhalt der Luftqualität sowie der Artenvielfalt im urbanen Raum unerlässlich. Bäume, Hecken und Gebüsche dienen Insekten, Vögeln und Kleintieren als Nistplätze und Nahrungsquelle.
Kaum verwunderlich, dass darum selbst der Naturschutzbund Deutschland für grüne Fassaden wirbt. Und auch die Lebensqualität der Stadtbewohner wird durch grüne Freizeit- und Erholungsflächen wie Parks, botanische Gärten und urbane Wälder signifikant verbessert. Der Traum vom „Urban Jungle“ scheint damit optionslos.
Angesichts dieser Tatsachen bedarf es Konzepten, die in urbanen Ballungsgebieten nicht nur Arbeits- und Wohnfläche, sondern auch Grünflächen schaffen. Eigentlich keine schwere Aufgabe, denn Hauswände und Hausdächer zur Begrünung gibt es zur Genüge. Zudem ergeben sich durch die Kombination aus futuristischer Formgebung und grünem Gebäudeflor unglaublich atmosphärische und kunstvolle Meisterwerke.

Grünes Design mit langer Tradition
Neu ist die Idee der grünen Fassaden nicht. Etwaige Architekturprojekte gab es bereits in antiken Reichen wie dem alten Ägypten oder Babylon. Man denke nur an die Hängenden Gärten der Semiramis, die als eines der sieben Weltwunder in die Geschichte eingingen. Die Terrassengärten waren auf stufenweise ansteigenden Flachdächern darunter liegender Gebäude arrangiert, wodurch die Dächer weitläufige Außenanlagen zur vielfältigen Nutzung schufen.
In der Gartenkunst sind Kletterpflanzen seit jeher ein gestalterisches Element zur Begrünung von Mauern und Hauswänden. Der Vorteil an vielen dieser Pflanzen ist, dass sie unglaublich pflegeleicht sind und kaum Aufmerksamkeit bedürfen. Einmal gepflanzt, wuchern sie praktisch von selbst und benötigen allenfalls Wuchshilfen oder gelegentliche Erziehungsschnitte zur Formkorrektur.
Berühmt für ihren üppigen Grünbewuchs sind diesbezüglich Gartenkonzepte wie der Steingarten und Naturgarten. Gerade die Atmosphäre im Steingarten lebt von Polsterstauden und niedrigwachsenden Pflanzenteppichen, die über das steinerne Mauer- und Beetrelief wuchern. Im Naturgarten schaffen wiederum Schlingpflanzen und Rankengewächse herrliche Grundlagen für grüne Torbögen und Pflanzsäulen. Diese sind im Übrigen auch für Gartenarten wie dem Bauerngarten oder Kräutergarten charakteristisch.
Apropos Kräutergarten: Die kunstvolle Kräuterspirale ist das beste Beispiel dafür, wie man in Abhängigkeit von der Pflanzhöhe schatten- und lichtliebende Pflanzen perfekt miteinander kombinieren kann. Das spielt insbesondere mit Blick auf hohe Hausfassaden, die große Schatten werfen, eine wichtige Rolle. Der spiralförmige Aufbau der Kräuterspirale gibt zudem eine herrliche Ergonomie vor, die sich in der Gebäudearchitektur zur Konzeption grüner Plattformen und höhenlastiger Fassadenbegrünung einsetzen lässt.

CO₂-aktive Pflanzen zur Fassadenbegrünung
Nun sollten es für eine klimafreundliche Fassadenbegrünung natürlich nicht irgendwelche Pflanzen sein. Ideal sind Gewächse, die sich durch einen besonders hohen CO₂-Umsatz auszeichnen. Je mehr CO₂ alias Kohlenstoffdioxid eine Pflanze bindet, desto größer sind ihr reinigender Effekt auf die Luft sowie die Bereitstellung an kostbarem Sauerstoff.
Wenn Fassaden Photosynthese betreiben
Die Aufnahme von CO₂ ist bei Pflanzen Teil der für sie überlebenswichtigen Photosynthese. Im Rahmen dieses Prozesses stellen Pflanzen aus Wasser und Kohlenstoffdioxid energiereiche Kohlenhydrate her, die sie als Nährstoffquelle nutzen. Sauerstoff entsteht dabei eher als für Pflanzen unbedeutendes Stoffwechselnebenprodukt.
Als Motor für die Synthese dient Sonnenlicht, das Pflanzen über den grünen Pflanzenfarbstoff Chlorophyll in ihren Blättern aufnehmen. Je mehr chlorophyllhaltige Blätter eine Pflanze also besitzt, desto höher ihr CO₂-Verbrauch. Unnötig zu erwähnen, dass Grünpflanzen diesbezüglich zu den leistungsstärksten CO₂-Absorbern gehören.
Urpflanzen als Erschaffer und Retter des Weltklimas
Laut einem Bericht von National Geographic absorbieren Pflanzen dank ihrer Photosynthese rund 29 Prozent aller weltweiten Emissionen aus der Luft. Sie tragen somit entschieden zur Reduzierung der CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre bei. Mehr noch, waren CO₂-aktive Pflanzen wie Moose und Farne ursprünglich sogar an der Entstehung unserer heutigen Atmosphäre beteiligt.
Die Urpflanzen existieren bereits vor gut 350 Millionen Jahren im Karbonzeitalter, als die Erdatmosphäre von geschwängert war vom Kohlenstoffdioxid der Magmadämpfe, die der damals noch vulkanisch hochaktiven Erdkruste entstiegen. Gerade die damals noch bis zu 30 m hoch wachsenden Farne bildeten zu jener Zeit riesige Urwälder, in denen sie das CO₂speicherten und in Sauerstoff umwandelten. Auf diese Weise erschufen sie eine für Tiere lebensfreundliche Umgebung und senkten die Temperaturen des prähistorischen Weltklimas.
Wichtig: Gerade mit Blick auf Moos als CO₂-aktive Grünpflanze wird auch die Bedeutung urbaner Feuchtgebiete wie Moore, Teiche und Seen deutlich. Denn Moose benötigen für ihr Wachstum einen konstant feuchten Untergrund, den sie außerhalb des Waldes maßgeblich nahe Grundwasservorkommen und Gewässern finden.

Wichtige CO₂-aktive Grünpflanzen im Überblick
An der klimastabilisierenden Funktion der Urwälder hat sich bis heute nichts geändert. Zwar sind die hier lebenden Farne inzwischen kleiner geworden, dafür kamen im Laufe der Jahrmillionen aber weitere CO₂-aktive Grünpflanzen hinzu, die ähnlich leistungsstark sind. Kultivieren kann man von diesen viele auch in der urbanen Grünlandschaft.
Eine besondere Empfehlung für Baumliebhaber ist hier übrigens der Kiri-Baum. Er gilt als König der Klimabäume und schlägt andere Baumarten in Sachen CO₂-Bilanz um Längen. Zur Auswahl passender Pflanzen für klimafreundliche Fassadenbegrünung hilft hingegen ein Blick ins Reich der klassischen Zimmerpflanzen. Unter ihnen findet sich eine Reihe klimafreundlicher Pflanzenarten, wie:
- Calathea
- Efeututen
- Farne
- Fensterblatt
- Grünlilien
- Korbmaranten
- Philodenron
Sie werden neben ihrer dekorativen Wirkung auch gerne als natürliche Luftreiniger zur Säuberung der Raumluft eingesetzt. Ein Aspekt, der inzwischen sogar für Arbeitgeber relevant ist. Denn um diverse Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes zum gesunden Raumklima in Betriebsstätten umzusetzen, sind CO₂-aktive Pflanzen immer noch die einfachste und auch günstigste Option. Gleiches gilt für das Home Office, das künftig immer öfter Großraumbüros und digitale Arbeitsräume im Betriebsgebäude ersetzen wird.

Vor allem die robusten Farne lassen sich als CO₂-aktive Pflanzen nicht nur indoor, sondern auch outdoor als Luftreiniger und Fassadenbegrünung einsetzen. Zudem eignen sich für den Außenbereich auch viele Sukkulenten, Polsterstauden, heimische Kletterpflanzen und niederlegende Halbsträucher zur Fassadenbegrünung. Schöne und mitunter sehr ziervolle Beispiele sind hier unter anderem:













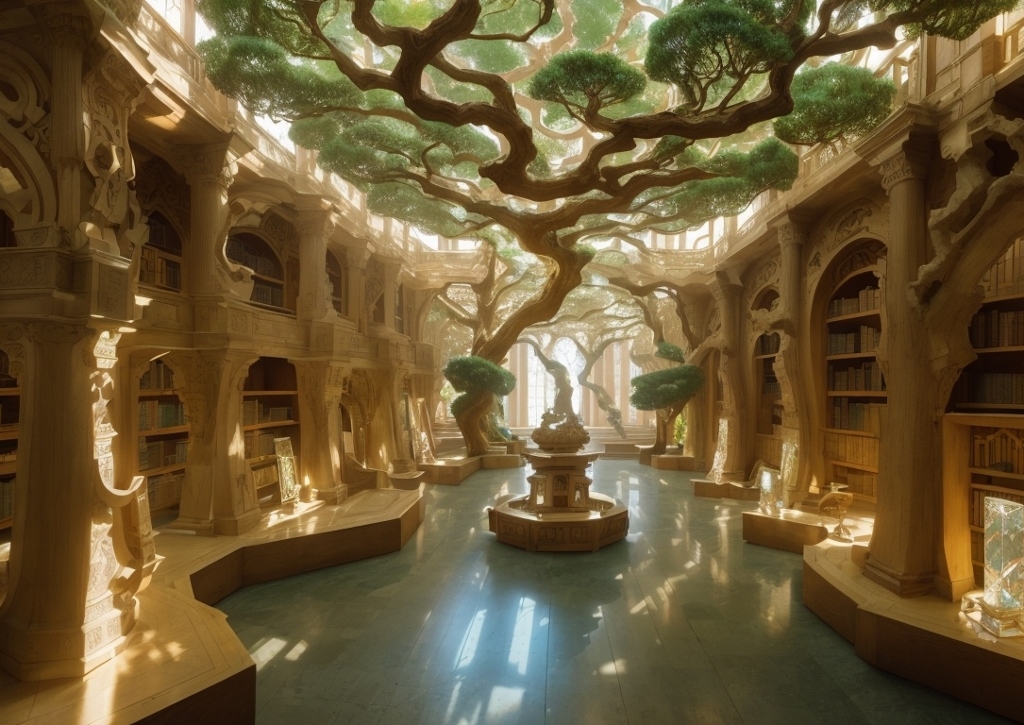

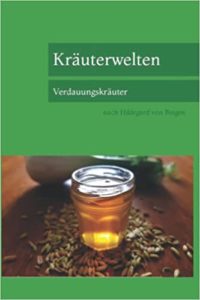
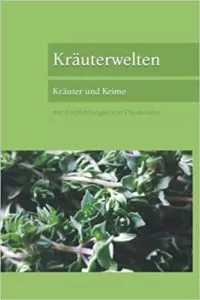
2 thoughts on “CO₂-aktive Pflanzen: Nachhaltiger Klimaschutz durch Fassadenbegrünung”
Bei den Bäumen sollten wir verstärkt (eigentlich wäre es fast ausschhließlich, angesichts der Situation, dass es nicht 5 VOR, sondern bereits 10 NACH zwölf ist) Paulownia- = Blauglocken-Bäume oder auch als „Kiri-Baum“ bezeichnet, pflanzen, weil seine CO²-Aktivität etwa 7 x so groß ist, als bei anderen Bäumen.
In ca. 6-10 Jahren erreicht dieser am schnellsten von allen Nutzhölzern wachsende Baum einen Stamm-Durchmesser von 30 bis 40 cm ! Eine heimische Fichte benötigt dafür immerhin 70 Jahre.
Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist der Kiri-Baum als Edel-Holz eingestuft und übertrifft so ziemlich alle anderen Nutzhölzer in Festigkeit, Torsionssicherheit, Feuer-, Wasser und Ungezieferresistenz.
Und ganz nebenbei produziert er in 7 Lebenszyklen etwa 10 x soviel Sauerstoff, als andere Bauhölzer.
Außerdem ist sein Holz (auch als „Aluminium“ der Bauhölzer genannt) trotz höchster Festigkeit federleicht, nahezu wie Balsaholz. Durch sein geringes Gewicht (im Durchschnitt ca. halb so schwer wie alle anderen Bauhölzer) ist die Transport-CO²-Bilanz auch nur in Etwa halb so groß.
Hallo Michael,
Ganz lieben Dank für diesen tollen Hinweis! Es bleibt zu hoffen, dass die Pflanzwut und hier insbesondere im Bereich der Baumpflanzungen in den kommenden Jahren signifikant zunimmt. Wir werden den Kiri-Baum in unseren Redaktionsplan mit aufnehmen und versuchen, in naher Zukunft einen Kulturratgeber dafür bereit zu stellen.