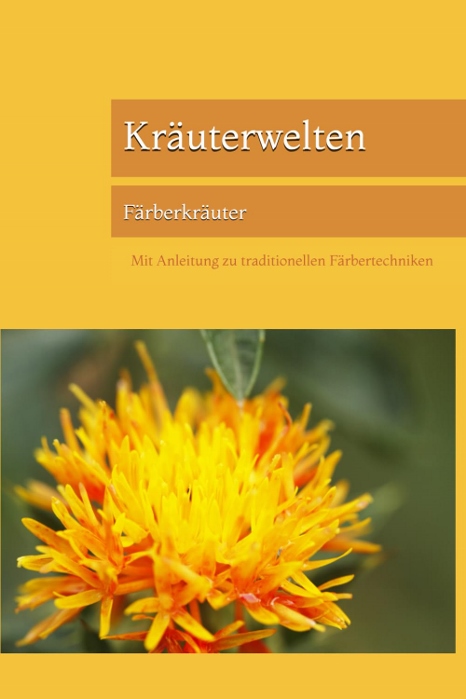Legenden besagen, dass Hexen einst mit Flugsalben das Fliegen lernten. Nach Anwendung der Hexensalbe sollen sie sich auf ihren Hexenbesen geschwungen haben und durch die Lüfte gehuscht sein. Bleibt die Frage, ob an derartigen Gerüchten etwas dran ist und, wenn ja, wie man so eine Salbe denn herstellt.
Inhaltsverzeichnis
ToggleWichtige Fakten zur Flugsalbe:
- Ob es so etwas wie eine Hexensalbe im Altertum wirklich gegeben hat, ist bis heute stark umstritten. Zwar tummeln sich in den historischen Archiven diverse Schriften, die sich mit Salben dieser Art beschäftigen, doch ihre Verfasser sind mehr als kritikwürdig.
- Viele vermeintliche Rezepturen stammen nicht von Hexen selbst, sondern von überwiegend männlichen Autoren. Diese fallen allesamt durch eine rege Fantasie in Bezug auf mögliche Zutaten und teils auch frauenfeindliche Äußerungen auf.
- Viel realistischer ist, dass es sich bei Flugsalben um eine Art Rauschmittel oder einen schlaf- bzw. visionenfördernden Balsam gehandelt hat. Sie dienten aller Wahrscheinlichkeit nach dem Zweck der magischen Einsicht oder des luziden Träumens.
- Was die angeblichen Zutaten für etwaige Salben anbelangt, so nennen altertümliche Autoren häufig hochgiftige Kräuter. Von der Zubereitung und Anwendung derartiger Mixturen wird an dieser Stelle dringend abgeraten. Denn ihr Einsatz kann im schlimmsten Falle tödlich enden.
- Besser geeignet sind beruhigende und ungefährliche Kräuterpflanzen oder auch hautpflegende Kräuter, die die Salbe dann zu einem hervorragenden Bestandteil der Nachtpflege für die Haut machen. Ein Rezept hierzu gibt es am Ende des Beitrags.
Von Hexenbesen, Geistreisen und Nahtoderfahrungen
Hexenrezepturen erfreuen sich gerade um die Zeit von Walpurgisnacht und Halloween großer Beliebtheit. Und gerade mittelalterliche Rezepte, die angeblich historisch belegt sind, erregen hier gerne Aufmerksamkeit.
Doch eines vorneweg: Der Begriff „Flug-Salbe“ wird in der Regel fehlgedeutet. Weder handelt es sich hierbei um ein Mittel zur Levitation, noch kann sie einen Hexenbesen magisch so verzaubern, dass er fliegt. Stattdessen ist mit dem „Flug“ eher ein schwebender bis umherfliegender Geist gemeint.
Viele der dokumentierten Salben von vermeintlichen Hexen enthalten Wirkstoffe, die als schlaffördernd oder psychedelisch gelten. Zudem sollen laut mittelalterlichen Rezepten für Hexensalbe auch diverse Giftkräuter wie
- Eisenhut,
- Natternkopf,
- Bittersüßer Nachtschatten,
- Bilsenkraut,
- Tollkirsche oder
- Stechapfel
in den Salben vorkommen. Dass diese einen an die Grenze zwischen Leben und Tod führen, erklärt sich von selbst.

Kinderfett, Fledermausblut und Frauenfeindlichkeit
Die Existenz von Flugsalben im Mittelalter ist bis heute umstritten. Zwar existieren diverse Rezepte aus dem 14. bis 16. Jahrhundert zu magischen Salben.
Deren Zutatenlisten erscheinen aber wenig realistisch und entspringen ausnahmslos der regen Fantasie männlicher Autoren. Diese waren seinerzeit auch die treibende Kraft hinter der Entstehung der Hexenverfolgung, die heute als einer der frühesten Fälle von demagogischer Volksverhetzung angesehen wird.
So nennt der italienische Arzt und Philosoph Gerolamo Cardano in seinem Rezept für die „Salbe der Lamien“ aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel Kinderfett und Ruß als Zutaten. Giambattista della Porta machte seinem Titel als Dramatiker ebenfalls alle Ehre, als er in seinem 1558 erschienen Buch „Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium“ von Komponenten wie Fledermausblut berichtete.
Wirkung von Hexensalben mehr Fiktion als Realität
Kenntnis über derartige Rezepturen für Salben, die das Fliegen lernen, erlangten die Verfasser meist entweder durch Hörensagen oder in Hexenprozessen unter Folter erzwungene Geständnisse.
Diesbezüglich sei erwähnt, dass nicht wenige Autoren der erwähnten Salbenrezepte Anhänger des sogenannten Hexenhammers, einer der wohl folgenschwersten Propagandaschriften des Mittelalters waren.
1486 von dem Dominikaner Heinrich Kramer unter dem Namen „Malleus maleficarum“ verfasst, listete der Hexenhammer eine Reihe angeblicher Kriterien auf, anhand derer sich eine Hexe erkennen ließe. Das ganze Werk wird heute als Vorläufer demagogischer Hetzschriften gegen Minderheiten und Andersdenkende betrachtet, das vornehmlich die Emanzipation von Frauen im christlich-patriarchalisch geprägten Europa des Mittelalters unterbinden sollte.
Einerseits wies die Schrift eine auffällig frauenfeindliche Rhetorik auf. Dernach seien Frauen für schwarze Magie angeblich anfälliger als Männer, weil sie aus der Rippe des Mannes geschaffen sind. Aus diesem Grund wären sie minderwertig, primitiv, leichter beeinflussbar und für den Teufel eher empfänglich.
Andererseits bediente sich Kramer allerlei, nicht nachweisbarer Argumente, die seiner persönlichen Vorstellung von Hexen zuträglich waren. So erklärte er die männliche Impotenz mit dem Zutun weiblicher Hexen, die Männern beim Geschlechtsverkehr das Glied wegzaubern.
Seine Aussage, dass sich Hexen mittels einer Salbe aus Kindergliedmaßen in die Lüfte erheben würden, ist ähnlich erfinderischer Natur. Die Behauptung reiht sich ein in eine Litanei unhaltbarer Anschuldigungen zur Rechtfertigung der Hexenverfolgung.
Wissenswertes: Heinrich Kramer sah sich zu seiner späteren Profession als Chefinquisitor der Hexenverfolgung berufen, nachdem er um 1480 Zeuge eines Prozesses gegen Juden in Trient wurde. Seine diskriminierende Ideologie im Hexenhammer lässt sich diesbezüglich mit den antisemitischen Äußerungen in Propagandaschriften des Naziregimes im Deutschen Reich vergleichen.

Giftkräuter und psychedelische Drogen
Ein weiterer Aspekt, der viele altertümliche Rezepte in Zweifel zieht, ist deren hoher Gehalt an giftigen Inhaltsstoffen. Genannt werden hier häufig hochtoxische Nachtschattengewächse.
Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass jede Hexe, die sich solch einen Giftkräuter-Cocktail zu Gemüte führte, eher daran stürbe denn zu levitieren. Einzig ihr Geist mag dann noch in die Lüfte entschwunden und zum Himmel aufgefahren sein.
Realistischer erscheinen da schon die psychedelischen Ingredienzien, die hier und da als Zutat für magische Salben erwähnt wurden. Wie bereits angedeutet, dienten etwaige Salben (wenn sie denn existierten) wohl eher der Hellsichtigkeit und dem luziden Träumen als der Levitation.
Ein Nachtschattengewächs, das hierzu durchaus Anwendung gefunden haben könnte, ist die schlaf- und visionenfördernde Alraune. Und auch der Einsatz von Cannabis als Rauschdroge ist in Europa schon seit tausenden von Jahren belegt.

Ein (ungefährliches) Originalrezept für Flugsalbe
Nun soll an dieser Stelle gewiss nicht die Zubereitung einer gift- und drogenlastigen Zaubersalbe vermittelt werden. Vielmehr geht die Empfehlung dahingehend, die historische Salbe als ein Hilfsmittel zur Meditation oder auch zur natürlichen Hautpflege zu begreifen.
Die Zutaten
Die nachstehende Rezeptur orientiert sich deshalb an dem ältesten überlieferten Rezept für eine unbedenkliche magische Salbe. Es stammt aus dem 1456 erschienenen Werk „Das Buch aller verbotenen Künste“ von dem Wittelsbacher Leibarzt, Hofdichter, Kräuterkundigen und Gelehrten Johannes Hartlieb und lautet wie folgt:
„Zu sölichem farn nützen auch man und weib, nemlich die unhulden, ain salb die hayst unguentum pharelis. Die machen sy uß siben krewtern und prechen yeglichs krautte an ainem tag, der dann dem selben krautt zugehört. Als am suntag prechen und graben sy Solsequium, am mentag Lunariam, am eretag Verbenam, am mittwochen Mercurialem, am pfintztag Barbam jovis, am freytag Capillos Veneris.
Daruß machen sy, dann salben mit mischung ettlichs pluotz von vogel, auch schmaltz von tieren; das ich als nit schreib, das yemant darvon sol geergert werden. Wann sy dann wöllen, so bestreichen sy penck oder stül, rechen oder ofengabeln und faren dahin. Das alles ist recht Nigramancia, und vast groß verboten ist.“

Sie sieben Hexenkräuter der Hexensalbe
Hartlieb berichtet davon, dass Hexen insgesamt sieben Zauberpflanzen für ihre magische Salbe verwendeten. Von diesen sei jedes einem bestimmten Wochentag zugeordnet und würde von den magischen Damen auch nur an dem entsprechenden Wochentag geerntet.
Zwar nannte auch Hartlieb in seinem Rezept Vogelblut als ungeheuerliche finale Zutat und beschrieb die Salbe deshalb als Nekromantie. Der Rest der Kräutersalbe enthält jedoch ausschließlich gut erforschte Heilkräuter, die man insbesondere bei äußerlicher Anwendung getrost als harmlos einstufen kann. Die Zutatenliste nach Hartlieb gestalte sich wie folgt:
- Sonntagskraut: Solsequium (Wegwarte)
- Montagskraut: Lunariam (Mondviole)
- Dienstagskraut: Verbene (Eisenkraut)
- Mittwochskraut: Mercurialem (Bingelkraut)
- Donnerstagskraut: Donnerbart / Barbam jovis (Dachhauswurz)
- Freitagskraut: Venushaar / Capillos Veneris (Frauenhaarfarn)
- Samstagskraut: Saturey (Bohnenkraut) oder Saturnkraut (Alraune)
Der Name des Samstagskrauts ist nicht in Hartliebs Original-Rezept enthalten. Allerdings können für jeden Kräuterkundigen einzig Saturey oder Alraune als wohlbekanntes Kraut des Saturn die logische Ergänzung sein.
Wer Alraune verwenden möchte, sollte dann aber sehr sparsam dosieren und nur sehr kleine Mengen nutzen. Denn auch, wenn das Kraut nach wie vor medizinische Nutzung erfährt, gehört es zu den giftigen Nachtschattengewächsen und darf auf keinen Fall überdosiert werden.

Die Herstellung
Das Grundrezept zur Herstellung von Salben lässt sich auch bei dieser Rezeptur als Orientierungshilfe nutzen. Nehmt von jedem Kraut einen Teil (bei Alraune nur einen halben Teelöffel) und mahlt die getrockneten Kräuter im Mörser zu feinem Pulver.
Anschließend erhitzt Ihr in einem Wasserbad etwas Bienenwachs und Pflegeöl (z.B. Kokosöl oder Mandelöl). Pro 10 ml Öl ist etwa 1 cm³ Bienenwachs zu verwenden. Sobald das Wachs geschmolzen ist, gebt Ihr die Kräuter hinzu und lasst die Salbe etwas abkühlen, bevor Ihr sie in saubere Salbentiegel abfüllt.
Die Flugsalbe wird traditionellerweise auf die Handflächen, Fußsohlen, Arm- und Kniekehlen sowie den Halsansatz und das Brustbein aufgetragen. So können die Wirkstoffe leicht in das Nervensystem einziehen und entfalten dort eine beruhigende, schlaffördernde und leicht anregende Wirkung.
Tipp: Alternativ könnt Ihr aus den Kräutern auch einen Ölauszug herstellen und diesen anschließend mit Bienenwachs zu Salbe verarbeiten. Unsere Anleitungen zur Herstellung von Ölauszügen aus der Kräuterküche gibt hierzu nützliche Tipps.
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von Das Grüne Archiv
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.